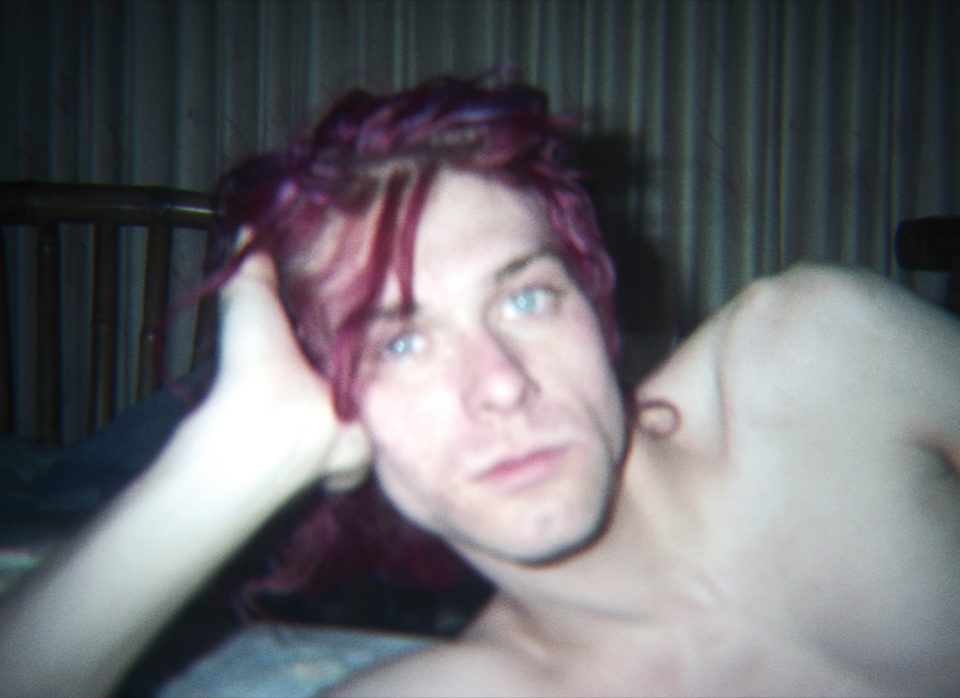Mythos und Realität: ein schönes Gegensatzpaar
Selten hat man einen Dokumentarfilm gesehen, der sein üppiges Budget so deutlich vor sich herträgt. Kein Zweifel, Brett Morgens Kurt-Cobain-Porträt konnte aus dem Vollen schöpfen, und das übrigens nicht nur in finanzieller Hinsicht: Alle haben sie mitgemacht: Cobains Eltern, sein Witwe Courtney Love, seine Tochter Frances Bean, seine Jugendfreundinnen und Wegbegleiter. Tonnen von zum Großteil bisher unveröffentlichtem Material wurden gesichtet und zusammengetragen, Cobains Tagebücher, Skizzen, von ihm selbst fabrizierte Mix-Tapes (auf eines von ihnen hat er „Montage of Heck“ gekritzelt), Super-8-Filme, Home Movies, es wurde geputzt, geschrubbt, animiert und montiert, was das Zeug hält, und seit dem Sundance Festival im Jänner liegt das Ergebnis öffentlich vor. Der Film wird gestürmt, wo immer er gespielt wird (nun auch im Wiener Gartenbaukino), und er erntet hymnische Begeisterung.
Das ist auch alles schön und gut, und natürlich macht Brett Morgen nichts falsch. Eine derart erschöpfende und intensive Musiker-Doku hat es vermutlich noch nie gegeben – oder nicht seit D.A. Pennebakers legendärem Dylan-Film Don’t Look Back. Und wahrscheinlich gibt es ja eine neue Generation, die noch nicht „alles“ über Kurt Cobain weiß, jenen blassen, freundlichen, musikalischen Jungen aus dem Kaff Aberdeen, Washington, der trotz (oder wegen) ungünstigster Umstände – Scheidung der Eltern, chronische Magenschmerzen seit Jugend an – zu einem der charismatischsten Rockstars aller Zeiten wurde. Natürlich berührt es einen, wenn der schwer drogensüchtige Star mit seiner neugeborenen Tochter spielt, natürlich faszinieren seine kryptischen Botschaften und seine hingekritzelten Zeichnungen.
Aber das wahre Phänomen ist doch, wie sehr der eigentlich bis zum Überdruss beschworene Rock’n’Roll-Mythos längst auch Kurt Cobain zu einer nicht (mehr) greifbaren Ikone gemacht hat. So viel „Menschliches“ und so viel gelebte Realität kann Brett Morgen gar nicht aufbieten, dass nicht das monumentale Bild Cobains, das sich in den 21 Jahren seit seinem Tod aufgebaut hat, stärker ist. Es ist kein Zufall, dass der Film immer dann so richtig abhebt, wenn Nirvana die Bühne betreten und die brachiale Wucht ihrer Grunge-Klassiker einen fast aus dem Kinosessel hebt. Die ganze Wut, der ganze Schmerz – das kann man nur im Rock’n’Roll so ausdrücken. Und wenn Cobain bei seinem letzten Konzert – so, als habe er „alles“ längst geplant – von der Bühne steigt und einem Fan seine Gitarre in die Hand drückt, weiß man: Das ist der Stoff, aus dem die Mythen sind. „When the legend becomes fact, print the legend” – der grandiose Satz aus John Fords The Man Who Shot Liberty Valance hat nichts an Bedeutung eingebüßt.