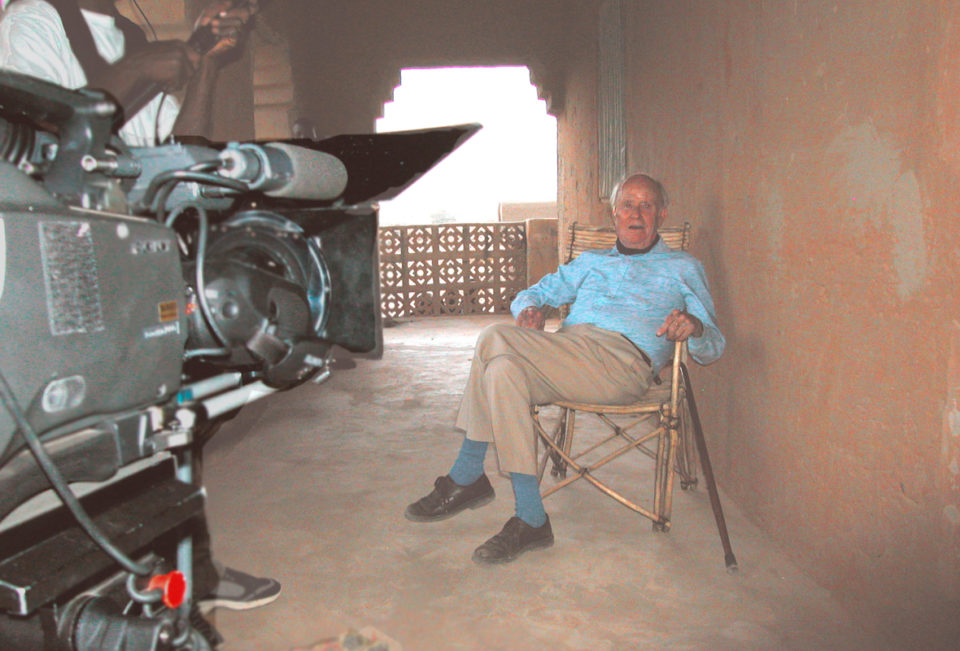Ende der Vierziger Jahre reiste Jean Rouch für erste dokumentarische Aufnahmen in die damalige französische Kolonie Niger. Dreißig Jahre später schilderte er, mittlerweile Wegbereiter des Cinéma Verité, in der deutschen Filmzeitschrift „Filmkritik“ seine Arbeit. Hier zwei Auszüge, die exemplarisch Rouchs abenteuerlichen Zugang zum Filmemachen und sein Verständnis von „Wirklichkeit“ darlegen.
In Niamey angelangt, wollten wir also einen Film drehen. Es waren damals viele Franzosen unterwegs, eine allgemeine Aufbruchsstimmung: Jacques Becker erzählt davon anschaulich in den Rendez-vous de Juillez.
Auf dem Flohmarkt hatte ich mir für 25.000 alte Francs eine 16mm-Bell & Howell gekauft, das sind umgerechnet heute 150 Francs. Sie gehörte vorher einem Kameramann der „News“ der U.S.-Armee. Während einer Panne auf dem Flug nach Niamey – der Pilot hatte noch nie einen Wüstenflug gemacht und musste notlanden – erklärte mir ein Kameramann, Edmond Séchan, der schon bei den Pygmäen gedreht hatte, wie man eine 16mm-Kamera bedient. Er erläuterte mir auch grundsätzliche Dinge, zum Beispiel, dass man immer mit einem Stativ drehen müsse.
Ich wollte selbstverständlich sofort einen langen Spielfilm drehen, – zum Glück (für die Filmgeschichte und für mich) ist von diesem Streifen, der La Chevelure magique [Das Zauberhaar] heißen sollte, nichts übrig geblieben: Hitze und falsche Lagerung haben ihn auf natürliche Weise zerstört. Während einer Schussfahrt durch Stromschnellen ging das Stativ zu Bruch. Wie sollte man ohne Stativ drehen! Ich wusste damals nur sehr wenig von früheren Versuchen. Das einzige was mir in Erinnerung war: Dziga Vertovs Der Mann mit der Kamera und die Arbeit seines Bruders Boris Kaufmann in À propos de Nice. Sonst nichts. Ohne Stativ zu drehen galt damals als Sakrileg. Die Bell & Howell war allerdings relativ handlich, hatte nur ein Objektiv (25 mm). Ich versuchte es, und es ging. Nach dem ersten, gescheiterten Versuch wollte ich jetzt ein Märchen aus Ayourou filmen. Da alle diese Geschichte kannten – sie ist unserem Aschenputtel vergleichbar – gab es, was die Spielhandlungen betrifft, keinerlei Schwierigkeiten. Was ich mit der Kamera machte, blieb den meisten verborgen: Sie wussten nicht, was ein Film ist, – es interessierte sie auch nicht weiter. Anschließend wollte ich eine Fahrt den Niger hinab filmen. Ich wusste nicht, wie ein „Achsensprung“ zustande kam, dass die Landschaften in wechselnden Richtungen durchs Bild glitten, je nachdem, welche Seite man wählte. Von diesem Film, der jeder Kontinuität entbehrt, sind nur ganz kurze Ausschnitte übrig geblieben, praktisch unbrauchbar. Die Reise selbst war sehr abenteuerlich. Der Strom war teilweise nicht befahrbar, wir mussten zu Fuß weiter, wir bauten Flöße, erlitten Schiffbruch. Hinzu kam, dass die Eingeborenen bestimmte Strecken des Stroms mieden, aus Angst vor den Geistern des Flusses. Neun Monate haben wir auf dem Wasser verbracht und so ein allgemeines Bild vom Charakter dieses riesigen Stroms gewonnen. (…)
Der Film, den ich damals drehte, auf dieser Reise, markiert meine erste echte Berührung mit dem professionellen Kino; es war die erste Fassung der Chasse à l’hippopotame, schwarzweiß, Kodak Tri-X (Negativ), mit unglaublich grobem Korn. Die französische Wochenschau hat diesen Film gekauft, nachdem ich ihn unter abenteuerlichen Bedingungen geschnitten hatte, – denn damals gab es ja für einen 16mm-Tonfilm so gut wie keine technischen Einrichtungen, alles musste von Hand und behelfsmäßig-bastlerisch gemacht werden. Anschließend wurde er, zum ersten Mal in Frankreich, auf 35mm aufgeblasen. Den Kommentar hatte ich zwar selbst geschrieben, eingesprochen wurde er dann von einem renommierten Sportjournalisten, der im Stil der Tour-de-France-Berichte das Auftauchen der Flusspferde ankündigte wie den Sprint des Spitzenreiters im Gelben Trikot. Diesem Kommentar unterlegt war eine schreckliche Musik, eine Art persischer Tanz, wie man ihn damals überall für „exotische Filme“ einsetzte. Einspruchsmöglichkeiten hatte ich keine, – meine Rechte waren mit der Garantie an 60% der Einspielergebnisse abgegolten. Dieser Film wurde als Vorfilm zu Rossellinis Stromboli gestartet und ich verdiente etwa 5000 Francs an der Sache. In Zukunft wollte ich diese Verwertung vermeiden und in letzter Instanz für meine Filme selbst verantwortlich sein. Ich kehrte wieder an den Niger zurück. (…)
Wenn man heute, rückblickend, überhaupt von einer Übereinstimmung zwischen Flaherty und meiner Arbeit sprechen kann, dann findet sie sich in der Haltung. Wie Flaherty habe auch ich eine Abscheu vor der reinen Theorie. Und es war seine unverzichtbare Entdeckung, dass die Kamera niemals eine Wand zwischen dem, der filmt und dem, der gefilmt wird, sein kann. Die Kamera hat teil und ist ein Teil der Begegnung mit dem Anderen. Die Kamera ist, wie Flaherty es formuliert hat, „partizipierende Kamera“. Grundsätzlich heißt das: nie mit versteckter Kamera drehen, nie Bilder stehlen, sondern immer den anderen in Kenntnis des Vorgangs setzen, mit allem was dazu gehört. Und eben auch, dass die Menschen, die ich gefilmt habe, später diese Filme zu sehen bekommen, was besonders ergiebig und unverzichtbar ist, wenn es sich um Menschen handelt, die weder schreiben noch lesen können. Als ich den Sorko-Fischern einige Exemplare meiner Abschlussarbeit gab, trennten sie die wenigen Fotografien heraus und hingen sie auf, das restliche Papier verwendeten sie anderweitig. Ich war überwältigt, als ich das erste Mal den Afrikanern, die ich bei der Flusspferdjagd gefilmt hatte, – es handelte sich um ein Remake der Chasse à l’hippopotame, nämlich Bataille sur le grand fleuve, in Farbe und stellenweise mit Originalton, der auf einem fahrbaren Tonbandgerät, dem sog. Scubietophone, nach einem französischen Erfinder gleichen Namens, aufgenommen worden war – als ich ihnen diesen Film vorführte. Wir bauten auf dem Dorfplatz den Projektor auf und alle starrten gebannt in die Lichtquelle, eine gewisse Zeit, dann wurden sie gewahr, dass nicht im Kreis, sondern dort hinten, auf dem Tuch das Entscheidende sich abspielte. Und nach fünfzehn Sekunden, nach fünfzehn Sekunden sprachloser Ohnmacht begriffen sie. Ein Begeisterungssturm brach los, sie schrieen wild durcheinander, – vom Ton war bei diesem Entzücken natürlich nichts zu hören. Sie erkannten sich wieder und kaum war die Projektion vorüber, musste der Film nochmals vorgeführt werden. Jetzt hörten sie hin. Ich hatte an den Höhepunkten der Jagd ein lied aus dieser Gegend unterlegt, das sog. Gaweï-Gaweï, in dem sehr anschaulich die Verfolgung des Wilds geschildert wird, und ich glaubte, dass es sehr gut zu den gefilmten Szenen sich fügen würde. Doch die Fischer und Jäger protestierten. Sie sagten, das Flusspferd habe sehr feine Ohren und würde bestimmt sofort untertauchen und verschwinden, wenn es diesen Gesang höre! Der Vorwurf war klar: ich würde versuchen, auf unzumutbare Weise versuchen, einer elementaren Aktivität (wie z.B. der Jagd) einen „Kommentar“ (das Lied der Gaweï-Gaweï) hinzuzufügen, ohne Rücksicht darauf, dass dieses Lied tatsächlich im Rahmen der Jagd nie gesungen werden darf. Die Jagd vollzieht sich schweigend. Ich verstand und wollte künftig derartige Fehler vermeiden.
Aus: „Jean Rouch erzählt“ (zusammengestellt von Hanns Zischler), in: „Filmkritik“ 1978, 1. Heft (Jg. 22), S. 3 – 43.